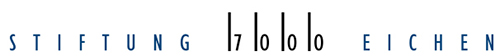Vortrag zum Festakt am 28. September 2002
Von Johannes Stüttgen
„Das soll ein Zeichen sein für die Notwendigkeit eines gewaltigen Tuns“
Als jüngst in Deutschland und sonst in Europa – ja, auch in China – die Flüsse in die Lebensräume der Menschen hereinbrachen, sind nicht nur ganze Städte, die Straßen und Häuser der unmittelbar Betroffenen überflutet worden, sonder auch unsere Begriffe, in denen wir uns eingerichtet haben und sicher fühlten. Das ist jetzt kein herbeigedachtes Bild; denn wir haben es unmittelbar erlebt: gemessen an dem, was da von außen über uns hereinbrach, waren diese Begriffe zu niedrig angesetzt. Ein Bild allerdings war es schon, es hatte sogar die numinose Wucht eines Urbildes und war beeindruckend einfach: Das Wasser wuchs, nichts konnte es halten, und das letzte, was wir nocht zu bieten hatten, waren Sandsäcke! Immerhin.
Vielleicht ist es hilfreich, gerade hier in der Galerie an der „Schönen Aussicht“ darauf hinzuweisen, dass Sandsäcke Plastiken sind, die simpelsten sogar, die es gibt. Wenn auch nicht wie die Filzrollen und Fettkuchen auf Schlitten, so wurden sie doch mit den primitivsten Mitteln in Kolonnen von Menschen von den Stellen, wo die LKWs nicht mehr weiterkamen, an ihren Zielort befördert; der war von der Zivilisation längst abgeschnitten. Und sonderbar: auch wenn kein Mensch da auf die Idee gekommen wäre, dass Sandsäcke Kunstwerke sind, führte gerade der Umgang mit ihnen, dieser phantastische Einsatz der freiwilligen Helfer aus der gesamten Republik, die plötzlich kein „weekend“ mehr kannten, für einen Moment den Aktionsbegriff vor, den niemand für möglich gehalten hatte, das ganze Potential – sprich: Kapital – handfester, elementarer Kreativität, das wie von selbst das Bild einer „sozialen Plastik“ mitlieferte. Nicht nur das Bild, sondern seinen realen Entstehungsort in den Menschen.
Obwohl es also nur Sandsäcke waren, die uns zu guter Letzt noch zur Verfügung standen und uns auf ganz besonders eindrucksvolle Weise demonstrierten, wie jämmerlich es – wenn es ums Ganze geht – um uns bestellt ist, sollten wir nicht das Willens- und Bewusstseinpotential vergessen, das gerade durch sie mobilisiert und ins Bild gerückt wurde: dass wir nämlich mit unserer Intelligenz, was die Regelung der Verhältnisse auf der Erde und die Gestaltung der Welt betrifft, an den kritischen Punkt gekommen sind, wo die alten Dämme und mit ihnen eben auch die vertrauten Begriffe nicht wirklich noch etwas taugen. Und dass, wenn es ums Ganze geht, nur noch das Eine zählt: dass der Mensch tatsächlich über sich hinauswachsen kann. Das und sonst nicht ist das Kapital der Gesellschaft, das haben wir erfahren.
Allerdings – auch das sollte sich in uns eingebrannt haben – reichen die Sandsäcke auf Dauer nicht hin. Sie reichten ja nicht einmal mehr für deisen Fall. Auf das Alte im Notfall nur noch weitere Meter aufzubocken, ist eine wenig überzeugende Perspektive. Keine Frage, es war des Mindeste, dass die, denen die Existenz buchstäblich weggeschwemmt wurde, sofort mit dem nötigen Geld versorgt wurden – und gehen wir einmal davon aus, dass das auch tatsächlich geschehen ist (ich weiß es nicht) –, so ist doch nicht zu leugnen, dass wiederum gerade dieser selbstverständliche Vorgang die wirkliche Absurdität besonders krass vor Augen führt, nämlich die realistische Aussicht auf die Wiederholung, die dann zeigt, dass auch diese gewaltige Anstrengung nur auf Sand gesetzt war.
Die Zusammenhänge liegen klar auf de Hand: so wenig es nutzen wird, die alten Dämme bloß weiter zu erhöhen, so wenig aussichtsreich ist es, diesen Problemen, vor denen – wie uns versichert wird, aber gar nicht erst versichert werden muss – erst der Anfang erlebt wird, mit dem Systemrepertoire des herrschenden Geldbegriffs beikommen zu wollen. Wie der Kreislauf des Wassers offenbar ganz neu ins Bewusstsein rücken muss, sind auch die Kreisläufe des Geldes neu zu bedenken, ja überhaupt erst gewahr zu werden. Die Idee das Geldes und die Idee der Elbe sind beides dasselbe. Dennoch steht dieser schöne Zaubersruch solange nur erst am Himmel, als wir nicht willens sind, den inneren Zusammenhang zwischen der sogenannten „Jahrhundertflut“ und jener Überschwemmung zu realisieren, die beschönigend „Wahlkampf“ genannt wird – vermutlich ist letztere sogar noch verheerender. An der Formfrage will ich mich gar nicht erst aufhalten, jeder Sandsack ist schöner als das da verabreichte Material. Wirklich entscheidend ist, dass die in Aussicht gestellten Mittel, zwischen denen zu wählen war, in keinem Verhältnis zu der Herausforderung stehen, die tatsächlich die Zeit uns jetzt stellt. Es sind alles Mittel der Vergangenheit, und sie sind schon dadurch widerlegt, dass wir im Ernst nicht einmal selbst an sie glauben. Die Wasser werden sich jedenfalls nicht an die Koalitionsvereinbarungen halten. Die Zeit der Sandsäcke ist gezählt, wie die Stimmen gezählt sind, und wir sollten uns nicht dümmer stellen, als wir sind: Dann wir wissen es alle.
Der jedenfalls, der in Kassel 1972 auf der documenta 5 100 Tage lang die Idee der „Direkten Demokratie durch Volksabstimmung“ – die ja nichts anderes besagt als: Nimm die Sache selbst in die Hand! – vorgestellt und 10 Jahre später, heute und hier, feiern – Joseph Beuys also wusste das schon lange. Der von ihm proklamierte „Erweiterte Kunstbegriff“, der sogar von den Gutwilligen als ein Vorgriff angesehen wurde, stellt sich aus heutiger Sicht erstaunlich zeitgemäß heraus – paradoxerweise weil er immer noch der Zeit voraus ist. „Die einzige Genialität, die ich besitze“, notierte er einmal, „ist die, dass ich mich mit dem Druck der Zeit bewege, während andere sich dagegen bewegen“ – und er setzte an den Rand dieser Notiz die Frage: „Was ist der Druck der Zeit?“ (1) Joseph Beuys brauchte keine „Jahrhundertflut“, wie vielleicht wir noch, um diesen „Druck der Zeit“ zu spüren, und zwar schon im Denken zu spüren; denn in der Tat: Das Denken ist ein Spürorgan. Es nimmt die Kräfte wahr, bevor sie sich in den Materieverhältnissen niederschlagen lassen. Gerade die Kasseler documenta-Ausstellungen belegen, was die Beuys-Beiträge betrifft, diese Schwellenfuntion aufs genauste.
Niemand ist meines Wissens häufiger und in dieser Kontinuität zur documenta geladen worden als Joseph Beuys, fünfmal hintereinander: 1964, 1968, 1972, 1977, 1982 und – nicht zu vergessen – 1987, als sein documenta 7-Beitrag, eben die Errichtung der Skulptur „7000 Eichen“, abgeschlossen wurde; da allerdings war Joseph Beuys schon seit anderthalb Jahren nicht mehr auf der Erde. Ich habe immer wieder auf diese Zeit-Koinzidenz mit der 7000-Eichen-Setzung hingewiesen und tue das auch jetzt wieder: Der Tod ist als Faktor in seiner gesamten arbeit präsent, nie aber als ein Ende, sondern immer als Anfang, nämlich als genau jener Anfang, der in der Regel nicht für möglich gehalten wird, an dem aber erst die Kunst beginnt. Nicht von ungefähr war es dieses Nicht-für-möglich-Halten, das nicht nur die Arbeit von Joseph Beuys, sondern auch seine Person immer seitens der Zeitgenossen begleitet hat, diese nie nachlassende Erstaunlichkeit. Die eben betrifft auch die Abfolge der 5 + 1 documenta-Beiträge, die einer auf dem anderen so stimmig aufbaut, dass von einem Lebewesen die Rede sein kann, das sich entwickelt hat. Die berühmte Rede mit dem Titel: „Eintritt in ein Lebewesen“ [Buchbestellungen unter: http://www.fiu-verlag.com], die Joseph Beuys bei seiner 4. documenta – der documenta 6, 1977 – gehalten hat (es war die documenta mit der „Honigpumpe am Arbeitsplatz“), handelt genau von dieser Methodik, die er selber Zeit seines Lebens erforscht und umgesetzt hat. Um aber auf jene Erstaunlichkeit. zurückzukommen, die ich mit der Stimmigkeit in der Hervorbringung eines Lebewesen gleichgesetzt habe, ist vor allem noch zu sagen, dass es das Charakteristikum der documenta-Beiträge von Joseph Beuys war, dass sie ja nicht nur – spätestens seit der 4. documenta (mit dieser großartigen Raum-Installation hier im Hause, deren Bestandteile alle heute im Darmstädter „Block Beuys“ präsentiert sind) – der Höhepunkt der jeweiligen documenta war (dies jedenfalls aus meiner Sicht, aber durchaus nicht nur aus meiner), sondern dass man eine Steigerung nicht mehr für möglich hielt. Und doch trat sie promt dann ein.
Genau des ist auch der Grund, dass die 7000-Eichen-Skulptur mit einigem Recht als der Höhepunkt der ducumenta-Beiträge von Beuys angesehen werden kann. Es kommt ja nicht so oft vor, dass man das 20-jährige Jubiläum der Errichtung eines Kunstwerks extra feiert. Es ist ja das erste Kunstwerk, das buchstäblich eine ganze Stadt belegt, sie überall durchdringt und immer wieder – ich will nicht sagen: in Atem hält, aber gehörig beschäftigt. Das begann schon, als noch eigentlich gar nichts da war außer jener 1. Eiche nebst ihrer Basaltsäule auf dem Friedrichsplatz (eben vor dem Museum und nicht in ihm) und den 7 weiteren ersten auf dem Pferdemarkt. Und doch war es Beuys gelungen, die ganze noch zukünftige Energie, deren Umsetzung in das angekündigte Werk damals niemand für möglich gehalten hatte, unmittelbar wirksam werden zu lassen, sozusagen vorab. Bildhauerisch war das eine Meisterleistung, realisiert durch die Präsentation einer „Vorab-Skulptur“, die er dem Prototyp der Endkonstellation, der 1. Eiche + Basaltsäule zugeordnet hatte: das keilförmig auf sie als Spitze zulaufende Depot der 6992 für 6992 noch nicht gepflanzte Bäume vorgesehenen Basaltsäulen.
Meine Güte, das war an sich schon eine grandiose Plastik, gültig nach den höchsten Regeln der Verteilung von Masse und der Form – ein Aufsehen erregendes documenta-Stück! Nur eben die Kasselaner, für die das Ganze gedacht war, waren zu einem großen Teil ganz schön außer sich; denn jeder konnte sich an seinen 10 Fingern abzählen, dass dieser Riesenkeil aus 6992 Steinbrocken in der 100-Tage-Schonfrist der documenta nicht weggeräumt sein würde. Und der Oberbürgermeister Hans Eichel, der damals noch nichts von dem 20 Jahre später auf ihn zukommenden Elbe-Wahnsinn und den zig Milliarden ahnte, die er zu mamagen haben würde, geriet gehörig in Bedrängnis, weil jetzt ja nicht nur die Idee „Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“, die er der Stadtverwaltung schließlich auch nur als „Kunst“ plausibel verkaufen konnte, sondern nun sogar noch das ganz reale Faktum zig tausender Steinriesen mitten auf Kassels Vorzeigeplatz vom Ende der 100 Tage documenta an als „Kunst“ völlig außerhalb aller Regularien und buchstäblich unter seiner Verantwortung stand. Wäre wenigstens eine Überschwemmung in Aussicht gewesen und diese Basaltsäulen Sandsäcke, das hätte eingeleuchtet, aber 1982 war die Welt noch in Ordnung. Nein, sagte Beuys, ist sie nicht! In Ordnung ist nur dieser Basaltsäulenkeil, dafür garantiere ich. Und dass überhaupt alles in Ordnung kommt und dass auch der Basaltsäulenkeil verschwindet und dahin verteilt wird, wo er hingehört, dafür sorge ich.
Hans Eichel war damals weise genug, die Angelegenheit dem Künstler tatsächlich zu überlassen – er sollte sich heute daran erinnern, dass er damit nicht schlecht gefahren ist. Denn diese Regel, es dem Künstler zu überlassen, die Joseph Beuys damals an diesem Modellfall für sich in Anspruch nahm, gilt, wenn sie aus ihrem documenta-Korsett herausgesprengt und auf die Demokratiefrage erweitert wird, für jeden Menschen. Die Frage, ob jener Beuys-Coup vor 20 Jahren tatsächlich demokratisch war, erübrigt sich; denn, wie gesagt, hat es sich bei dieser Sache ja erst um eine „Vorab-Skulptur“ gehandelt! Viel interessanter ist die Frage der Demokratie bei der jetzigen „End-Skulptur“, den 7000 Eichen selbst, die der Stadt Kassel nicht nur ein neues Bild außen geliefert hat, sondern durchaus auch eins innen. Denn diese Basaltsäulen neben den Bäumen stehen ja nicht nur an der Straße, sondern sie stehen, seitdem sie stehen und nicht mehr liegen, für eine „innere Demokratie“ – eine solche nämlich, die nicht delegierbar ist, weil sie in jedem Menschen als einem Künstler gründet. Sie fordern die Stadt, die sie zweifellos auch schmücken, dennoch auch heraus: dass diese sich „mit dem Druck der Zeit“, gleichsam am Wachstum dieser besonderen Bäume entlang, immer mehr auf die Kreativität ihrer Bürger zurückbezieht, die – damit kann man getrost rechnen – am Ort, wo sie leben und arbeiten, für manche spezielle Frage, die bürokratisch-verwalterisch vielleicht gar nicht zu lösen ist, letztlich das wirklich stimmige Ergebnis herausfinden werden.
Um es klipp und klar hier zu sagen: Die Plastik „7000 Eichen“ ist eine Verpflichtung, und die Welt hat ein Auge darauf. Ihr Erhalt bedeutet, grundsätzlich neue Wege zu suchen. Es ist mit ihrem Wesen – und auch mit der Garantie, die Stadt mit der Übernahme dieses einzigartigen Geschenks gegeben hat, unvereinbar, sie in ihrer Substanz anzutasten. Die jetzt ganz aktuelle Problematik der Landgraf-Karl-Straße wird diesbezüglich ein Prüfstein sein. Davon, dass hier eine im sinne sieses Kunstwerks passable Lösung möglich und in ihren Grundzügen auch schon konzipiert ist, habe ich mich in den letzten Tagen überzeugen können. In diesem Fall – wie in allen anderen Fällen, die den Kasseler Bürgern, namentlich dem Verein „7000 Eichen“ und der heute zur Gründung bestimmten Stiftung besser bekannt sind als mir – gilt, was Joseph Beuys am 7. Dezember 1982 bei einer Strategiedebatte mit seinem Mitarbeiterstab hier in Kassel ausgeführt hat: „Man kommt uns ja immer mit den ,Sachzwängen‘ – und es heißt dann: hier kann keine Eiche hin, weil hier Asphalt ist! Davon lassen wir uns aber gar nicht beeindrucken! Wir müssen dann sagen: wie bitte – Sachzwang? Was soll das sein ein Sachzwang?
Gut, sprechen wir also als erstes über die Sachzwänge! Wenn Sie sagen, hier kann keine Eiche hin, weil hier Asphalt ist, und das ein Sachzwang sein soll, dann sagen wir sofort: aber meine Herren, das ist uns zu unwissenschaftlich, das ist uns zu ungenau! Was Sie sagen, ist höchstens ,Sachzwang 1‘! Aber wir sind zuständig für ,Sachzwang 2‘! Und ,Sachzwang 2‘ lautet: hier muss eine Eiche hin, also muss der Asphalt weg! Jetzt wollen wir doch mal beide ,Sachzwänge‘ schön neben einander stellen und mal prüfen, welches denn nun der stärkere ist – oder? – Die Argumente sind auf unserer Seite, aber dafür müssen wir sorgen! Dafür sind wir da!“ (2)
Und genau dafür ist von heute an auch die Stiftung da, dafür und dafür zu mitzusorgen, dass mit dem Wachstum der Bäume auch das Bewusstsein der Menschen wächst, nämlich das Bewusstsein für die Idee jener Skulptur, für die wiederum 7000 Eichen ihrerseits eine „Vorab Skulptur“ ist und die Joseph Beuys die „Soziale Skulptur“ genannt hat. Diese wurzelt in den Menschen selbst, sie ist nichts Abstraktes und Ausgedachtes und nicht indoktrinierbar. Aber sie ist zu entdecken in jedem, wenngleich erst in ihrem Keimzustand – aber das kann uns schon jede Eiche, jeder Baum sagen, dass wirklich Lebendiges als Keim entsteht. Dass das so ist, dafür steht der Basaltstein und auch dafür, dass in Zukunft „Natur“ in der Freiheitsnatur des Menschen neu begründet und nur in ihr begründet sein wird. Das wiederum ist nur möglich, wenn der Mensch diese seine Natur in sich selbst entdeckt. Dabei allerdings wird ihm, dem Menschen, die Natur schon helfen, darauf können wir uns verlassen.
Am 9. Januar 1984, einen Monat vor der Begehung des „Goldenen Lochs“, in dem Joseph Beuys am 12. April danach seinen 3001. Baum, den „Vernunftbaum“ (eine Eiche) pflanzte, sagte er: „Die Natur hat ihre eigene Intelligenz, die lässt sich auf Dauer nicht so quälen!“ (3) Genau eben dies ist es gewesen, was wir in jüngster Zeit so eindringlich von jener Flut zu spüren bekommen haben. Und gespürt haben wir auch die zu engen Begriffe, die uns die Seele zugeschnürt haben. Sie müssen erweitert werden. In diesem Fall waren es die „gequälten Wasser“. Sie mussten sich erweitern, weil unsere Begriffe zu eng gewesen sind und immer noch sind. Diese verkreuzte Logik, die sich in unserem Ich kreuzt, ist es, die wir endlich jetzt wahrnehmen und wahrhaben lernen sollen. Und zur Hilfe dafür hat Joseph Beuys diese große Skulptur „7000 Eichen“ hinterlassen, diese so unendlich komplexe und doch so unendlich einfache Skulptur, die wirklich jeder gegreifen kann, wenn er nur will. In der Tat, wir brauchen das Allereinfachste, um begreifen zu lernen; das schlagend einfache Bild der großen Flut ist der Beweis dafür.
Joseph Beuys aber hat, 20 Jahre davor, den vielleicht noch entscheidenderen Beweis geliefert, den nämlich, dass solche einfachen Bilder sehr wohl nicht negativ sein müssen, sonder positiv sein können. Sie kommen nicht so dramatisch daher, das ist wahr. Wahr ist aber auch, dass auch sie für die nötige Dramatik sorgen – wenn wir sie denn zu schätzen lernen, das heißt, wenn wir selbst in dieses „gewaltige Tun“ einsteigen. Den ersten Basaltsäulenkeil, der nachweisbar für gehörigen Wirbel in der Stadt sorgte, den hat Joseph Beuys schon erledigt. Er lag nur auf dem Friedrichsplatz. Der nächste, viel größere, liegt uns, der ganzen Menschheit, jetzt auf der Seele – wie es heute heißt: im Bauch. Das jedenfalls sollten wir nach all diesen sehr einfachen Bildern allmählich begreifen: Wir sollten nicht länger so genügsam sein. Parteien reichen nicht mehr und auch Sandsäcke nicht. Joseph Beuys, dessen Arbeit wir heute hier 20 Jahre später neu besiegeln – mit der Gründung dieser Stiftung –, hat uns geeignetere Mittel Vorgeführt. Ergreifen wir sie also!
(1) Eva, Wenzel und Jessyka Beuys: JOSEPH BEUYS BLOCK BEUYS.
München 1990. S. 23
(2) Aus persönlichen Notizen von Johannes Stüttgen
(3) Aus persönlichen Notizen von Johannes Stüttgen
Der Titel des Vortrags zitiert Joseph Beuys in einem Podiumsgespräch am 27.01.1983 in Wien, Hochschule für angewandte Kunst. In: Kat. „BEUYS zu Ehren“. Städtische Galerie im Lenbachhaus, München 1986. S. 88